Accattone – Wer nie sein Brot mit Tränen aß: Ein schonungsloses Porträt römischer Randexistenz
Pier Paolo Pasolinis Debütfilm *Accattone – Wer nie sein Brot mit Tränen aß* aus dem Jahr 1961 ist weit mehr als nur ein Film; er ist ein erschütterndes, poetisches und zutiefst humanistisches Kunstwerk, das den Zuschauer in die düsteren Gassen und trostlosen Vororte Roms entführt. Hier begegnet man Accattone, einem Kleinganoven und Zuhälter, dessen Leben von Armut, Hoffnungslosigkeit und der Suche nach einem Sinn geprägt ist. Pasolini, selbst ein Kind der römischen Vororte, zeichnet ein authentisches und ungeschöntes Bild einer Welt, die von der italienischen Nachkriegsgesellschaft oft übersehen wurde. *Accattone* ist ein Film, der unter die Haut geht, zum Nachdenken anregt und noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleibt.
Die Geschichte von Accattone: Ein Leben am Rande
Vittorio Cataldi, genannt Accattone (was so viel wie „Schnorrer“ oder „Bettler“ bedeutet), verbringt seine Tage mit Faulenzen, Kartenspielen und dem Ausnutzen anderer. Er lebt von den Erträgen seiner Prostituierten Maddalena, bis diese von rivalisierenden Zuhältern brutal zusammengeschlagen und ins Gefängnis gebracht wird. Plötzlich steht Accattone vor dem Nichts. Ohne Geld und ohne Perspektive versucht er verzweifelt, einen Ausweg aus seiner Misere zu finden. Er verliebt sich in die junge und unschuldige Stella, die er zur Prostitution zwingen will. Doch Stella wehrt sich, und Accattone erkennt langsam die moralische Verkommenheit seines Handelns.
In seiner Not beschließt Accattone, einen ehrlichen Job anzunehmen, aber seine Bemühungen scheitern an seiner eigenen Unfähigkeit und der tief verwurzelten Verachtung für die bürgerliche Welt. Er gerät in kriminelle Machenschaften, um seine Familie zu ernähren, und wird schließlich bei einem missglückten Einbruch von der Polizei verfolgt. Auf der Flucht verunglückt Accattone tödlich. Seine letzten Worte sind ein Fluch und eine resignierte Akzeptanz seines Schicksals.
Pasolinis Realismus: Eine schonungslose Wahrheit
Pasolini verzichtet in *Accattone* bewusst auf jegliche Form von Glamour oder Romantik. Er zeigt das Leben in den römischen Vororten so, wie es ist: rau, schmutzig und von Armut geprägt. Die Darsteller sind Laien, die Pasolini auf der Straße gefunden hat, und ihre Authentizität verleiht dem Film eine unglaubliche Glaubwürdigkeit. Die Dialoge sind in römischem Dialekt gehalten, was die Nähe zur Realität noch verstärkt. Pasolini scheut sich nicht, die hässlichen Seiten des Lebens zu zeigen: Gewalt, Kriminalität, Prostitution und soziale Ungerechtigkeit. Aber er tut dies immer mit einer tiefen Menschlichkeit und einem Verständnis für seine Figuren.
*Accattone* ist ein Film des italienischen Neorealismus, einer Stilrichtung, die in den Nachkriegsjahren entstand und sich durch ihre realistische Darstellung sozialer Probleme auszeichnet. Pasolini geht jedoch über den reinen Neorealismus hinaus. Er verbindet die realistische Darstellung mit einer poetischen und symbolischen Ebene. So werden die trostlosen Schauplätze der römischen Vororte zu Metaphern für die innere Verfassung seiner Figuren.
Die Musik von Bach: Ein Kontrast, der berührt
Ein wesentliches Element von *Accattone* ist die Verwendung von Musik Johann Sebastian Bachs. Pasolini setzt Bachs erhabene Klänge bewusst als Kontrast zur trostlosen Realität des Films ein. Die Musik verleiht den Bildern eine zusätzliche Dimension und verstärkt die emotionale Wirkung. Sie erinnert den Zuschauer daran, dass selbst in der größten Dunkelheit noch Schönheit und Hoffnung existieren können. Die Musik Bachs wird so zu einem Ausdruck der Sehnsucht nach einer besseren Welt, die für Accattone und seine Leidensgenossen unerreichbar scheint.
Accattone: Mehr als nur ein Gauner
Obwohl Accattone auf den ersten Blick unsympathisch wirkt, gelingt es Pasolini, ihn als einen komplexen und vielschichtigen Charakter darzustellen. Accattone ist kein Monster, sondern ein Mensch, der in einem Teufelskreis aus Armut und Gewalt gefangen ist. Er ist faul, egoistisch und skrupellos, aber er hat auch Momente der Zärtlichkeit, der Reue und der Sehnsucht nach einem besseren Leben. Er ist ein Produkt seiner Umgebung, aber er ist auch ein Mensch mit eigenen Träumen und Hoffnungen.
Accattones tragische Figur berührt den Zuschauer, weil er in ihm etwas von der eigenen Menschlichkeit erkennt. Er ist ein Spiegelbild unserer eigenen Schwächen und Unvollkommenheiten. Er erinnert uns daran, dass jeder Mensch, egal wie tief er gefallen ist, eine zweite Chance verdient. Aber *Accattone* ist auch eine Warnung vor den zerstörerischen Kräften von Armut und sozialer Ungerechtigkeit.
Die Bedeutung von Accattone in der Filmgeschichte
*Accattone* ist ein Meilenstein des italienischen Kinos und ein wichtiger Beitrag zum Neorealismus. Der Film hat zahlreiche Filmemacher beeinflusst und gilt als Vorläufer des Autorenkinos. Pasolinis schonungslose Darstellung der römischen Randexistenz hat die italienische Gesellschaft aufgerüttelt und zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den sozialen Problemen des Landes geführt.
*Accattone* ist aber auch ein zeitloser Film, der bis heute seine Gültigkeit nicht verloren hat. Seine Themen – Armut, soziale Ungerechtigkeit, Hoffnungslosigkeit und die Suche nach einem Sinn im Leben – sind auch heute noch relevant. *Accattone* ist ein Film, der zum Nachdenken anregt, der berührt und der noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleibt.
Die symbolische Ebene von Accattone
Neben der realistischen Darstellungsebene enthält *Accattone* auch eine tiefere, symbolische Ebene. Viele Szenen und Motive des Films sind reich an Bedeutung und laden zur Interpretation ein.
- Der Name Accattone: Der Name selbst ist symbolisch. Er verweist auf die Rolle Accattones als Außenseiter und Bettler, der am Rande der Gesellschaft lebt.
- Die trostlosen Schauplätze: Die heruntergekommenen Häuser, die schmutzigen Straßen und die öden Landschaften der römischen Vororte symbolisieren die innere Verfassung der Figuren und ihre Hoffnungslosigkeit.
- Die Musik von Bach: Wie bereits erwähnt, steht die Musik Bachs im Kontrast zur trostlosen Realität des Films und symbolisiert die Sehnsucht nach einer besseren Welt.
- Accattones Tod: Accattones Tod am Ende des Films ist nicht nur tragisch, sondern auch symbolisch. Er steht für das Scheitern seiner Bemühungen, ein besseres Leben zu führen, und für die Unmöglichkeit, aus dem Teufelskreis von Armut und Gewalt auszubrechen.
Schauspieler und ihre Rollen: Authentizität pur
Die Besetzung von *Accattone* ist ein weiterer Grund für die Authentizität des Films. Pasolini setzte bewusst auf Laiendarsteller, die er in den römischen Vororten fand. Sie brachten ihre eigenen Lebenserfahrungen und ihre eigene Sprache in den Film ein und verliehen ihren Figuren eine unglaubliche Glaubwürdigkeit.
| Schauspieler | Rolle | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Franco Citti | Vittorio „Accattone“ Cataldi | Citti war ein Maurer, bevor Pasolini ihn entdeckte. Seine Darstellung des Accattone ist eindringlich und unvergesslich. |
| Franca Pasut | Stella | Pasut war eine Fabrikarbeiterin. Ihre Darstellung der unschuldigen Stella ist berührend. |
| Silvana Corsini | Maddalena | Corsini war eine Prostituierte. Ihre Darstellung der Maddalena ist authentisch und schonungslos. |
| Paolo Guidi | Bardassa | Guidi war ein Straßenhändler. Seine Darstellung des Bardassa ist komisch und tragisch zugleich. |
Fazit: Ein Film, der bewegt und nachwirkt
*Accattone – Wer nie sein Brot mit Tränen aß* ist ein Film, der unter die Haut geht und noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleibt. Es ist ein schonungsloses Porträt römischer Randexistenz, das aber auch von tiefer Menschlichkeit und Poesie geprägt ist. Pasolini zeigt uns eine Welt, die von Armut, Hoffnungslosigkeit und Gewalt geprägt ist, aber er vergisst nie, die Würde und die Sehnsucht nach einem besseren Leben seiner Figuren zu zeigen.
*Accattone* ist ein Film, der zum Nachdenken anregt, der berührt und der uns daran erinnert, dass jeder Mensch, egal wie tief er gefallen ist, eine zweite Chance verdient. Es ist ein Meisterwerk des italienischen Kinos und ein zeitloser Film, der auch heute noch seine Gültigkeit nicht verloren hat.
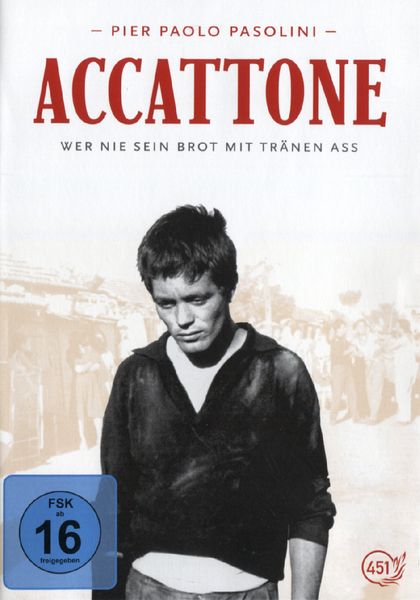
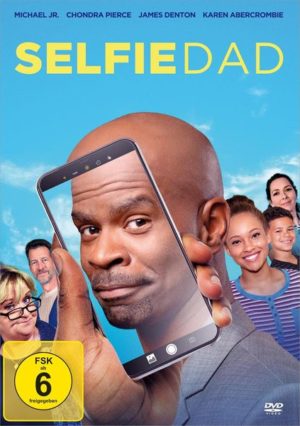
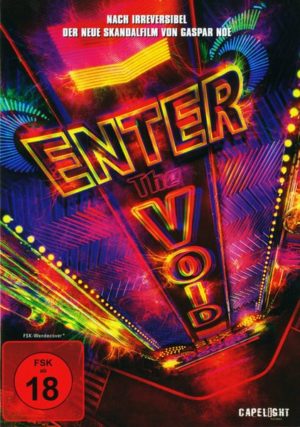
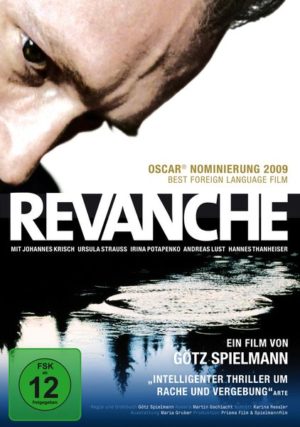

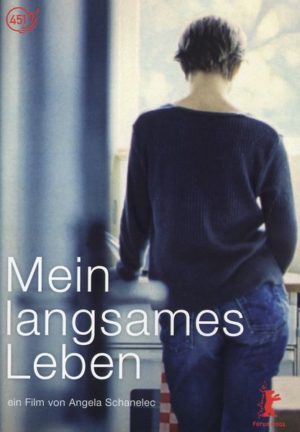
![Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos & Die unbezähmbare Leni Peickert - Edition Filmmuseum [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/die-artisten-in-der-zirkuskuppel-ratlos-die-unbezaehmbare-leni-peickert-edition-filmmuseum-2-dvds-dvd-alfred-edel-300x428.jpeg)

![Schattenzeit Special Edition [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/schattenzeit-special-edition-2-dvds-dvd-300x424.jpeg)