Eika Katappa/Der Tod der Maria Malibran – Edition Filmmuseum: Ein Doppelmeisterwerk des deutschen Experimentalfilms
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des deutschen Experimentalfilms der 1970er Jahre mit dieser einzigartigen Doppel-DVD der Edition Filmmuseum. Diese Edition vereint zwei visionäre Werke von Werner Schroeter: „Eika Katappa“ (1969) und „Der Tod der Maria Malibran“ (1972), zwei Filme, die bis heute nichts von ihrer Intensität und künstlerischen Kühnheit verloren haben. Erleben Sie Film als radikale Kunstform, die Konventionen sprengt und die Grenzen des Seh- und Denkbaren neu definiert.
Eika Katappa: Ein rauschhaftes Fest der Bilder und Klänge
„Eika Katappa“, Schroeters erste Langfilmregie, ist ein expressives und rauschhaftes Kaleidoskop aus Bildern, Tönen und Performances. Der Film ist weniger eine narrative Erzählung als vielmehr ein Zustand, eine hypnotische Reise durch die Innenwelten seiner Protagonisten. Schroeter selbst bezeichnete den Film als „Versuch, einen Film zu machen, der sich selbst produziert“, und tatsächlich entsteht der Eindruck einer unmittelbaren, ungefilterten Kreativität, die sich Bahn bricht. Die Handlung, sofern man überhaupt davon sprechen kann, dreht sich um die schicksalhafte Begegnung zweier Frauen, Magdalena Montezuma und Mascha Rabben, deren exzentrische Performances und bizarre Dialoge den Film prägen.
„Eika Katappa“ ist ein Fest der camp-Ästhetik, der exaltierten Gesten und der opulenten Kostüme. Schroeter bedient sich freimütig aus dem Fundus der Oper, des Theaters und des Varietés, um eine einzigartige visuelle Sprache zu schaffen. Die Musik spielt eine zentrale Rolle, von klassischen Opernarien bis hin zu experimentellen Klängen, die die emotionalen Zustände der Figuren widerspiegeln. Der Film ist eine Herausforderung für den Zuschauer, ein Trip in eine Welt jenseits der Konventionen, ein Fest für die Sinne. „Eika Katappa“ ist ein Schlüsselwerk des frühen Schroeter, ein radikales Manifest für eine neue Art des Filmemachens. Es ist ein Film, der polarisiert, der provoziert, der aber vor allem eines tut: Er lässt niemanden unberührt.
Der Tod der Maria Malibran: Eine Oper in Bildern
Mit „Der Tod der Maria Malibran“ schuf Schroeter ein noch radikaleres und persönlicheres Werk. Der Film ist eine Hommage an die legendäre Opernsängerin Maria Malibran, deren kurzes und tragisches Leben Schroeter als Spiegelbild der eigenen Künstlerexistenz begreift. Malibran, eine Diva des Belcanto, starb jung an den Folgen eines Sturzes vom Pferd. Schroeter inszeniert ihren Tod als ein sinnliches und schmerzhaftes Requiem, eine Oper in Bildern.
Der Film verzichtet weitgehend auf eine konventionelle Handlung. Stattdessen reiht Schroeter Tableaus und Performances aneinander, die Malibrans Leben und Leiden, ihre Triumphe und ihre inneren Konflikte evozieren. Magdalena Montezuma, Schroeters Muse, verkörpert Malibran mit einer Intensität und Hingabe, die unter die Haut geht. Ihre exaltierten Gesten, ihre pathetischen Blicke und ihre kraftvolle Stimme verleihen der Figur eine fast übermenschliche Präsenz.
„Der Tod der Maria Malibran“ ist ein Film über die Besessenheit, über die Ekstase und über den Schmerz des Künstlers. Schroeter thematisiert die Frage nach der Rolle der Kunst in einer Welt, die von Konventionen und Zwängen geprägt ist. Er zeigt Künstler als Getriebene, als Leidende, aber auch als Visionäre, die uns neue Wege des Sehens und des Fühlens eröffnen. Der Film ist ein Meisterwerk der Stilisierung, ein Fest der Farben, der Kostüme und der Musik. Er ist ein Requiem für die Kunst, für die Schönheit und für die Vergänglichkeit des Lebens.
Die Edition Filmmuseum: Ein Schatz für Filmliebhaber
Die Edition Filmmuseum präsentiert „Eika Katappa“ und „Der Tod der Maria Malibran“ in restaurierter Form, mit umfangreichem Bonusmaterial. Die Doppel-DVD enthält nicht nur die Filme selbst, sondern auch Interviews mit Werner Schroeter, Essays von Filmwissenschaftlern und Archivmaterial, das einen tiefen Einblick in die Entstehung der Filme und in das Werk des Regisseurs gewährt. Die Edition ist ein Muss für alle, die sich für den deutschen Experimentalfilm, für das Werk Werner Schroeters und für die Geschichte der Filmkunst interessieren.
Diese Edition bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, zwei Schlüsselwerke des deutschen Experimentalfilms in bestmöglicher Qualität zu erleben. Tauchen Sie ein in die Welt von Werner Schroeter und lassen Sie sich von seiner künstlerischen Vision inspirieren. Erleben Sie Film als Kunstform, die Konventionen sprengt und die Grenzen des Seh- und Denkbaren neu definiert. „Eika Katappa“ und „Der Tod der Maria Malibran“ sind Filme, die Sie nicht vergessen werden.
Magdalena Montezuma: Die Muse des Werner Schroeter
Kein Text über Schroeter wäre vollständig ohne eine Würdigung von Magdalena Montezuma, seiner wichtigsten Muse und kongenialen Partnerin. Montezuma war eine außergewöhnliche Künstlerin, eine exzentrische Persönlichkeit und eine Ikone des deutschen Undergroundfilms. Ihre Zusammenarbeit mit Schroeter prägte dessen Werk maßgeblich und verlieh seinen Filmen eine unverwechselbare Note.
Montezuma war mehr als nur eine Schauspielerin. Sie war eine Performerin, eine Selbstdarstellerin, eine Diva, die jede Rolle mit ihrer ganzen Persönlichkeit ausfüllte. Ihre exaltierten Gesten, ihre pathetischen Blicke und ihre kraftvolle Stimme verliehen ihren Figuren eine fast übermenschliche Präsenz. Sie war eine Meisterin der Improvisation, eine Künstlerin, die sich lustvoll den Konventionen widersetzte und die Grenzen des Ausdrucks immer wieder neu auslotete.
In „Eika Katappa“ und „Der Tod der Maria Malibran“ verkörpert Montezuma Figuren von großer emotionaler Tiefe und Komplexität. Sie spielt Frauen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die von ihren Träumen und Sehnsüchten getrieben werden, die aber auch unter ihren inneren Konflikten leiden. Ihre Performances sind intensiv, leidenschaftlich und oft auch schmerzhaft. Sie sind ein Spiegelbild der menschlichen Existenz, ein Ausdruck der Schönheit und der Tragik des Lebens.
Die Edition Filmmuseum würdigt Magdalena Montezuma mit umfangreichem Bonusmaterial, das Einblicke in ihr Leben und Werk gewährt. Entdecken Sie die faszinierende Persönlichkeit einer außergewöhnlichen Künstlerin und erleben Sie ihre unvergesslichen Performances in den Filmen von Werner Schroeter.
Werner Schroeter: Ein Grenzgänger des Kinos
Werner Schroeter (1945-2010) war einer der wichtigsten und radikalsten Vertreter des Neuen Deutschen Films. Sein Werk zeichnet sich durch eine einzigartige künstlerische Vision, eine expressive Bildsprache und eine kompromisslose Haltung aus. Schroeter war ein Grenzgänger des Kinos, ein Künstler, der sich lustvoll den Konventionen widersetzte und die Grenzen des Erzählens immer wieder neu auslotete.
Schroeter begann seine Karriere als Amateurfilmer und drehte zunächst experimentelle Kurzfilme, die bereits seine späteren Themen und Stilmittel vorwegnahmen. In den 1970er Jahren gelang ihm der Durchbruch mit Filmen wie „Eika Katappa“, „Der Tod der Maria Malibran“ und „Willow Springs“, die auf internationalen Festivals gefeiert wurden. In den folgenden Jahren drehte Schroeter zahlreiche Spielfilme, Operninszenierungen und Theaterstücke, die ihn zu einem der wichtigsten deutschen Künstler seiner Generation machten.
Schroeters Filme sind oft von einer melancholischen Grundstimmung geprägt. Er thematisiert die Frage nach der Rolle der Kunst in einer Welt, die von Konventionen und Zwängen geprägt ist. Er zeigt Künstler als Getriebene, als Leidende, aber auch als Visionäre, die uns neue Wege des Sehens und des Fühlens eröffnen. Seine Filme sind ein Fest der Stilisierung, ein Ausdruck der Schönheit und der Tragik des Lebens.
Die Edition Filmmuseum bietet Ihnen die Möglichkeit, das Werk Werner Schroeters in seiner ganzen Vielfalt zu entdecken. Erleben Sie seine frühen Experimentalfilme, seine großen Spielfilme und seine Operninszenierungen. Tauchen Sie ein in die Welt eines außergewöhnlichen Künstlers und lassen Sie sich von seiner Vision inspirieren.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Was macht „Eika Katappa“ und „Der Tod der Maria Malibran“ so besonders?
Diese beiden Filme sind Schlüsselwerke des deutschen Experimentalfilms und des Werks von Werner Schroeter. Sie zeichnen sich durch ihre radikale Form, ihre expressive Bildsprache und ihre Auseinandersetzung mit den Themen Kunst, Tod und Besessenheit aus. Sie sind ein Muss für alle, die sich für anspruchsvolles und innovatives Kino interessieren.
Für wen ist diese Edition geeignet?
Diese Edition ist ideal für Filmliebhaber, die sich für den deutschen Experimentalfilm, für das Werk Werner Schroeters und für die Geschichte der Filmkunst interessieren. Sie ist auch für Studierende und Wissenschaftler der Filmwissenschaft, der Kunstgeschichte und der Theaterwissenschaft von Interesse.
Welches Bonusmaterial ist in der Edition enthalten?
Die Edition Filmmuseum bietet umfangreiches Bonusmaterial, darunter Interviews mit Werner Schroeter, Essays von Filmwissenschaftlern und Archivmaterial, das einen tiefen Einblick in die Entstehung der Filme und in das Werk des Regisseurs gewährt.
Sind die Filme restauriert?
Ja, „Eika Katappa“ und „Der Tod der Maria Malibran“ wurden für diese Edition restauriert, um die bestmögliche Bild- und Tonqualität zu gewährleisten.
Ist diese Edition auch für Einsteiger in das Werk von Werner Schroeter geeignet?
Obwohl die Filme anspruchsvoll sind, bietet die Edition durch das umfangreiche Bonusmaterial eine gute Einführung in das Werk von Werner Schroeter. Sie ist daher auch für Einsteiger geeignet, die bereit sind, sich auf ein ungewöhnliches Kinoerlebnis einzulassen.
![Eika Katappa/Der Tod der Maria Malibran - Edition Filmmuseum [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/eika-katappa-der-tod-der-maria-malibran-edition-filmmuseum-2-dvds-dvd-magdalena-montezuma.jpeg)
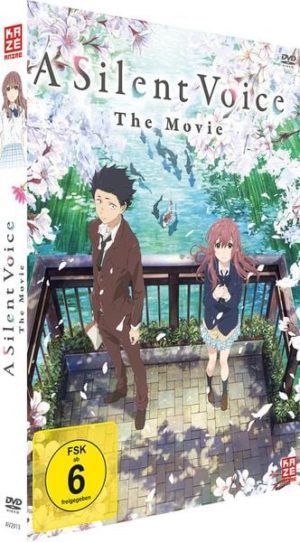
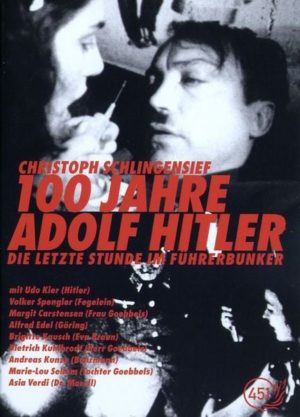
![Lilly Schönauer - Collection [3 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/lilly-schoenauer-collection-3-dvds-dvd-lilly-schoenauer-300x449.jpeg)

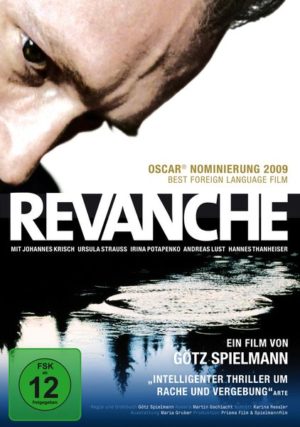
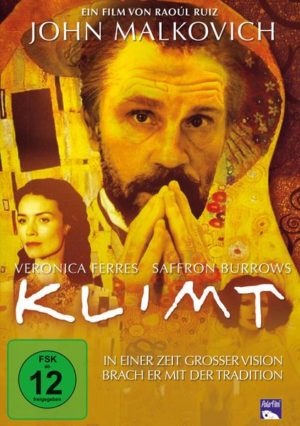
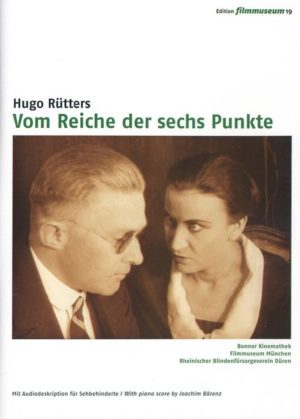
![Dekalog Limited Edition [6 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/dekalog-limited-edition-6-dvds-dvd-henryk-baranowski-300x423.jpeg)