Eine Reise der Seele: „Wie im Himmel / Wie auf Erden“ – Zwei Filme, die berühren und inspirieren
Tauchen Sie ein in die wundervolle Welt von Kay Pollaks Meisterwerken „Wie im Himmel“ und „Wie auf Erden“. Diese beiden Filme sind mehr als nur Unterhaltung; sie sind eine Einladung, über das Leben, die Liebe, die Musik und die Bedeutung von Gemeinschaft nachzudenken. Eine Geschichte voller Wärme, Humor und tiefgründiger Einsichten, die Ihr Herz berühren und Sie noch lange nach dem Abspann begleiten wird.
„Wie im Himmel“: Ein Dirigent findet seine Melodie
„Wie im Himmel“ erzählt die Geschichte von Daniel Daréus, einem international gefeierten Dirigenten, der nach einem Herzinfarkt beschließt, in sein nordschwedisches Heimatdorf zurückzukehren. Er sehnt sich nach Ruhe und einem einfachen Leben, fernab des hektischen Musikbetriebs. Doch die Dorfbewohner, allen voran der örtliche Pfarrer und die Mitglieder des Kirchenchors, wittern ihre Chance. Sie bitten Daniel, den Chor zu leiten – und so beginnt eine Reise, die nicht nur die musikalischen Fähigkeiten des Chors, sondern auch das Leben aller Beteiligten nachhaltig verändert.
Daniel, der einst die größten Orchester der Welt dirigierte, findet sich plötzlich mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe von Laiensängern konfrontiert. Jeder von ihnen bringt seine eigenen Sorgen, Träume und Konflikte mit in den Chor. Daniel erkennt, dass es bei seiner Aufgabe nicht nur um das Einstudieren von Musikstücken geht, sondern vielmehr darum, die Menschen zu ermutigen, ihre Stimme zu finden, ihre Ängste zu überwinden und ihr volles Potenzial zu entfalten.
Durch die Musik gelingt es Daniel, die verschlossenen Herzen der Dorfbewohner zu öffnen und eine Atmosphäre des Vertrauens und der Akzeptanz zu schaffen. Er hilft ihnen, ihre persönlichen Probleme anzugehen, sei es die schwierige Ehe von Inger und Stig, die Aggressionen von Arne oder die Unsicherheit von Lena. Doch auch Daniel selbst wird durch die Begegnung mit den Dorfbewohnern verändert. Er lernt, sich seinen eigenen Dämonen zu stellen und die wahre Bedeutung von Freundschaft, Liebe und Gemeinschaft zu erkennen.
„Wie im Himmel“ ist ein Film, der Mut macht, seinen eigenen Weg zu gehen, seine Träume zu verwirklichen und sich auf die Suche nach dem Glück zu begeben. Er ist eine Hommage an die Kraft der Musik, die Menschen verbinden und heilen kann. Und er ist eine Erinnerung daran, dass das wahre Glück oft in den kleinen Dingen des Lebens zu finden ist.
Die Charaktere in „Wie im Himmel“: Ein Spiegelbild der menschlichen Seele
Die Figuren in „Wie im Himmel“ sind vielschichtig und authentisch gezeichnet. Jeder von ihnen hat seine Stärken und Schwächen, seine Träume und Ängste. Gerade diese menschliche Unvollkommenheit macht sie so nahbar und liebenswert.
- Daniel Daréus (Michael Nyqvist): Der berühmte Dirigent, der nach seiner Rückkehr in sein Heimatdorf eine neue Perspektive auf das Leben findet. Er ist ein sensibler und einfühlsamer Mensch, der die Fähigkeit besitzt, die Menschen um ihn herum zu inspirieren und zu motivieren.
- Lena (Frida Hallgren): Eine junge Frau, die von ihrem Mann misshandelt wird und im Chor neuen Mut und Selbstvertrauen findet. Sie ist ein Symbol für die Stärke und Widerstandsfähigkeit der Frauen.
- Stig (Niklas Falk): Der Pfarrer des Dorfes, der mit seiner eigenen Glaubenskrise zu kämpfen hat. Er ist ein Mann des Zweifels, aber auch der Hoffnung.
- Inger (Helen Sjöholm): Stigs Ehefrau, die sich nach Liebe und Anerkennung sehnt. Sie findet im Chor eine neue Gemeinschaft und die Möglichkeit, ihre musikalischen Talente zu entfalten.
- Arne (Lennart Jähkel): Ein aggressiver und jähzorniger Mann, der durch die Musik lernt, seine Emotionen zu kontrollieren und seine Wut in positive Energie umzuwandeln.
- Tore (André Sjöberg): Ein junger Mann mit einer geistigen Behinderung, der im Chor seine Stimme und seinen Platz findet. Er ist ein Symbol für die Inklusion und die Würde jedes einzelnen Menschen.
„Wie auf Erden“: Die Suche nach dem Paradies
„Wie auf Erden“ setzt die Geschichte von „Wie im Himmel“ fort, allerdings mit einer neuen Hauptfigur: Lena, die nach dem Tod von Daniel Daréus schwanger ist und versucht, ihr Leben neu zu ordnen. Sie zieht in ein kleines Haus am See und gründet dort ein alternatives Zentrum für spirituelle und künstlerische Entfaltung. Doch ihr Projekt stößt auf Widerstand bei einigen Dorfbewohnern, die Angst vor dem Neuen und Ungewohnten haben.
Lena ist fest entschlossen, ihren Traum von einer Gemeinschaft zu verwirklichen, in der jeder Mensch so sein kann, wie er ist, und in der Kreativität und Spiritualität einen hohen Stellenwert haben. Sie öffnet ihr Haus für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, die auf der Suche nach Sinn und Erfüllung sind. Doch die Konflikte mit den konservativen Kräften im Dorf eskalieren, und Lena muss sich fragen, ob ihr Idealismus in der Realität überhaupt Bestand haben kann.
„Wie auf Erden“ ist ein Film, der die Frage nach dem Paradies aufwirft und uns dazu anregt, darüber nachzudenken, wie wir eine bessere Welt gestalten können. Er ist eine Ermutigung, für unsere Überzeugungen einzustehen und uns nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen. Und er ist eine Erinnerung daran, dass das wahre Paradies nicht ein Ort ist, sondern ein Zustand des Herzens.
Die Charaktere in „Wie auf Erden“: Auf der Suche nach dem Glück
Auch in „Wie auf Erden“ begegnen wir einer Vielzahl von interessanten und vielschichtigen Charakteren, die alle auf ihre eigene Weise nach dem Glück suchen.
- Lena (Frida Hallgren): Die schwangere Witwe von Daniel Daréus, die ein alternatives Zentrum für spirituelle und künstlerische Entfaltung gründet. Sie ist eine starke und unabhängige Frau, die für ihre Ideale kämpft.
- Arne (Lennart Jähkel): Der ehemalige Chorknabe, der nun als Gemeindearbeiter tätig ist und Lena bei ihrem Projekt unterstützt. Er hat sich verändert und ist ruhiger und besonnener geworden.
- Siv (Ingela Olsson): Eine ältere Frau, die sich von Lena angezogen fühlt und in ihrem Zentrum eine neue Heimat findet. Sie ist eine weise und erfahrene Frau, die Lena mit Rat und Tat zur Seite steht.
- Fanny (Jakob Oftebro): Ein junger Mann, der sich in Lena verliebt und ihr bei der Verwirklichung ihres Traums hilft. Er ist ein sensibler und künstlerisch begabter Mensch.
- Preacher (Per Morberg): Ein charismatischer Prediger, der Lenas Projekt kritisch gegenübersteht und versucht, die Dorfbewohner gegen sie aufzuhetzen. Er ist ein Symbol für die konservativen Kräfte im Dorf.
Themen, die bewegen: Liebe, Glaube, Hoffnung und Gemeinschaft
Die Filme „Wie im Himmel“ und „Wie auf Erden“ behandeln eine Vielzahl von Themen, die uns alle bewegen. Dazu gehören:
- Liebe: Die Liebe in all ihren Facetten – die romantische Liebe, die freundschaftliche Liebe, die familiäre Liebe und die Liebe zu sich selbst. Die Filme zeigen, wie die Liebe uns heilen, verbinden und stärken kann.
- Glaube: Der Glaube an Gott, an die Menschlichkeit, an die Zukunft und an sich selbst. Die Filme stellen die Frage, was es bedeutet, zu glauben, und wie der Glaube uns in schwierigen Zeiten Halt geben kann.
- Hoffnung: Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf ein erfülltes Leben und auf die Verwirklichung unserer Träume. Die Filme zeigen, wie die Hoffnung uns antreibt und uns hilft, auch in dunklen Zeiten nicht aufzugeben.
- Gemeinschaft: Die Bedeutung von Gemeinschaft, von Zusammenhalt und von Solidarität. Die Filme zeigen, wie wir durch die Gemeinschaft wachsen, uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam etwas bewegen können.
- Musik: Die Kraft der Musik, die Menschen verbindet, heilt und inspiriert. Die Filme zeigen, wie die Musik uns hilft, unsere Emotionen auszudrücken, unsere Ängste zu überwinden und unsere Träume zu verwirklichen.
- Toleranz: Die Wichtigkeit von Toleranz, von Akzeptanz und von Respekt gegenüber anderen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Lebensweise. Die Filme zeigen, wie wir durch Toleranz eine friedlichere und gerechtere Welt schaffen können.
- Vergebung: Die Fähigkeit, anderen und uns selbst zu vergeben. Die Filme zeigen, wie die Vergebung uns von alten Lasten befreien und uns ermöglichen kann, einen Neuanfang zu wagen.
Die Musik: Der Soundtrack des Lebens
Die Musik spielt in den Filmen „Wie im Himmel“ und „Wie auf Erden“ eine zentrale Rolle. Sie ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Handlung, sondern auch ein Ausdruck der Emotionen und Gefühle der Charaktere. Die Filmmusik, komponiert von Stefan Nilsson, ist berührend, inspirierend und unvergesslich. Sie unterstreicht die Atmosphäre der Filme und verstärkt ihre Botschaft. Viele der Chorstücke, die im Film gesungen werden, sind traditionelle schwedische Volkslieder, die von Nilsson neu arrangiert wurden. Sie spiegeln die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat und ihrer Kultur wider.
Die Musik in den Filmen hat eine therapeutische Wirkung auf die Charaktere. Sie hilft ihnen, ihre Ängste zu überwinden, ihre Emotionen auszudrücken und ihre inneren Konflikte zu lösen. Sie verbindet sie miteinander und schafft eine Atmosphäre des Vertrauens und der Akzeptanz. Die Musik ist ein Symbol für die Hoffnung, die Liebe und die Gemeinschaft.
Die Drehorte: Eine Hommage an die schwedische Natur
Die Filme „Wie im Himmel“ und „Wie auf Erden“ wurden in Schweden gedreht, in der malerischen Landschaft von Norrland. Die Drehorte sind sorgfältig ausgewählt und tragen zur Atmosphäre der Filme bei. Die weiten Wälder, die klaren Seen und die idyllischen Dörfer spiegeln die Schönheit und Ruhe der schwedischen Natur wider. Sie sind ein Kontrast zum hektischen Leben in der Großstadt und laden zum Entschleunigen und Nachdenken ein.
Die Drehorte sind nicht nur Kulisse, sondern auch ein Teil der Geschichte. Sie symbolisieren die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat und ihrer Tradition. Sie sind ein Ort der Erinnerung, der Sehnsucht und der Hoffnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gibt es einen dritten Teil der Filmreihe?
Nein, aktuell gibt es keinen dritten Teil der „Wie im Himmel“-Reihe. „Wie auf Erden“ bildet den Abschluss der Geschichte rund um das Dorf und seine Bewohner.
Wo kann ich die Filme streamen oder kaufen?
Die Filme „Wie im Himmel“ und „Wie auf Erden“ sind auf verschiedenen Streaming-Plattformen wie Amazon Prime Video, iTunes und Google Play verfügbar. Sie können die Filme dort entweder kaufen oder leihen. Alternativ sind die Filme auch auf DVD und Blu-ray erhältlich.
Sind die Filme für Kinder geeignet?
Die Filme „Wie im Himmel“ und „Wie auf Erden“ sind thematisch anspruchsvoll und behandeln Themen wie Krankheit, Tod, Missbrauch und Gewalt. Daher sind sie eher für ein erwachsenes Publikum geeignet. Für Kinder und Jugendliche empfiehlt es sich, die Filme gemeinsam mit einem Erwachsenen anzuschauen und die Themen anschließend zu besprechen.
Welche Auszeichnungen haben die Filme erhalten?
„Wie im Himmel“ wurde für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert und hat zahlreiche weitere Auszeichnungen erhalten, darunter den Europäischen Filmpreis für die beste Musik und den schwedischen Filmpreis Guldbagge für den besten Film, die beste Regie und das beste Drehbuch. „Wie auf Erden“ wurde ebenfalls mit dem Guldbagge für die beste Musik ausgezeichnet.
Ist der Film „Wie im Himmel“ auf einer wahren Begebenheit beruhend?
Nein, die Geschichte von „Wie im Himmel“ ist fiktiv. Kay Pollak, der Regisseur und Drehbuchautor des Films, hat sich jedoch von seinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen inspirieren lassen. Die Themen, die im Film behandelt werden, sind universell und berühren viele Menschen.
Welche Sprache wird in den Filmen gesprochen?
Die Filme „Wie im Himmel“ und „Wie auf Erden“ sind auf Schwedisch. Sie sind jedoch mit deutschen Untertiteln oder einer deutschen Synchronisation erhältlich.
Wie lange dauern die Filme?
„Wie im Himmel“ hat eine Laufzeit von ca. 130 Minuten, „Wie auf Erden“ dauert ca. 125 Minuten.
![Wie im Himmel / Wie auf Erden - Special Edition [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/wie-im-himmel-wie-auf-erden-special-edition-2-dvds-dvd-michael-nyqvist.jpeg)
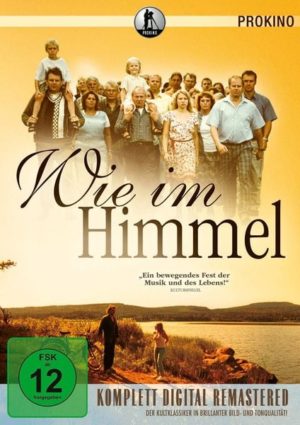
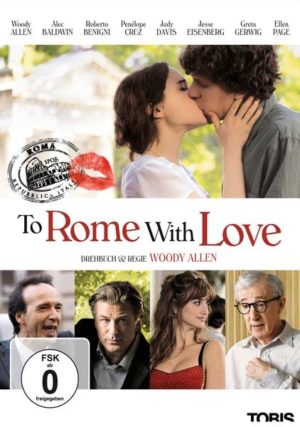
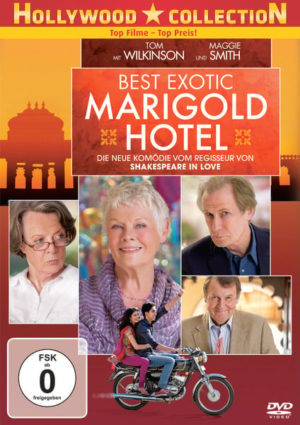
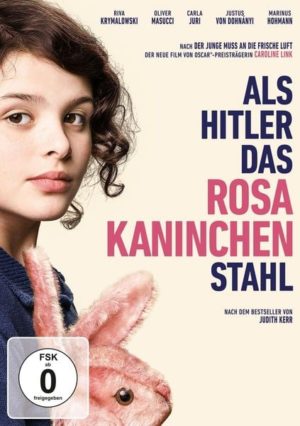
![Weingut Wader - Die komplette Serie (Alle 4 Teile) (Fernsehjuwelen) [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/weingut-wader-die-komplette-serie-alle-4-teile-fernsehjuwelen-2-dvds-dvd-henriette-richter-roehl-300x427.jpeg)
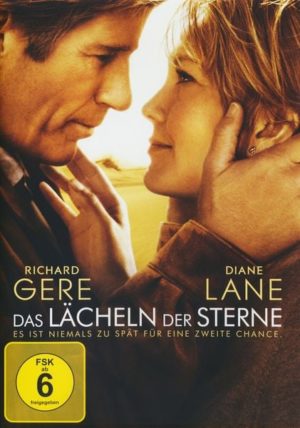
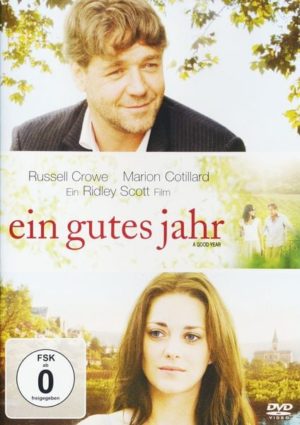
![Doc Martin - Staffel 9 [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/doc-martin-staffel-9-2-dvds-dvd-martin-clunes-300x423.jpeg)