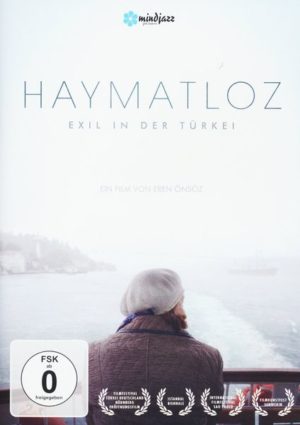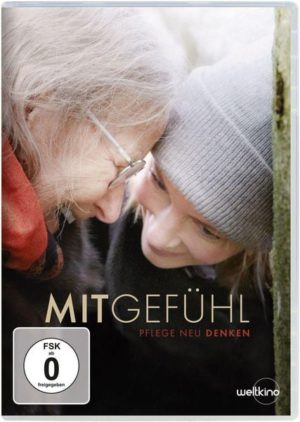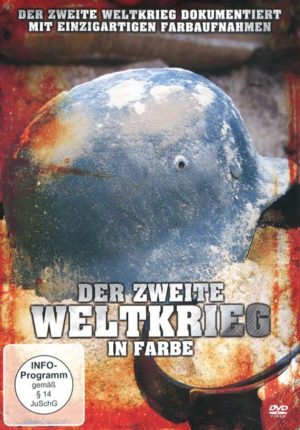Ein unvergessliches Zeugnis des Überlebenswillens: „Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr“
Betreten Sie eine Welt, die von Schrecken und Hoffnung zugleich geprägt ist. „Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr / Ein Lebender geht vorbei“ ist nicht nur ein Film, sondern ein tief bewegendes Denkmal menschlicher Widerstandsfähigkeit. Erleben Sie die wahre Geschichte eines der mutigsten Aufstände gegen die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs, ein Aufstand, der von Verzweiflung geboren und vom unbezwingbaren Willen zur Freiheit beflügelt wurde. Tauchen Sie ein in die packende Erzählung des Vernichtungslagers Sobibor und der heldenhaften Rebellion, die dort stattfand.
Dieser Film ist mehr als reine Geschichtsvermittlung. Er ist eine eindringliche Erinnerung an die dunkelsten Kapitel der Menschheit und ein flammender Appell, die Werte von Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit niemals aufzugeben. Lassen Sie sich von den Schicksalen der Überlebenden berühren, von ihrem Mut inspirieren und von ihrer unerschütterlichen Hoffnung anstecken. „Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr“ ist ein Film, der lange nach dem Abspann in Ihnen nachhallen wird.
Die Geschichte von Sobibor: Ein Ort des Schreckens und des Widerstands
Sobibor, ein Vernichtungslager im besetzten Polen, war ein Ort unvorstellbaren Leids. Hunderttausende Juden wurden hierher deportiert, um grausam ermordet zu werden. Doch inmitten dieser Dunkelheit keimte ein Funke Hoffnung auf: eine Gruppe von Gefangenen fasste den mutigen Entschluss, sich gegen ihre Peiniger zu erheben. Geplant und durchgeführt unter der Führung von Alexander Petscherski, einem sowjetischen Kriegsgefangenen, und Leon Feldhendler, dem Leiter des Lagerkomitees, wagten sie das Unmögliche.
Der Aufstand von Sobibor, der am 14. Oktober 1943 um 16 Uhr begann, war ein Akt verzweifelten Muts. Mit einfachsten Mitteln und unter Einsatz ihres Lebens kämpften die Gefangenen gegen die gut bewaffneten SS-Wachmänner. Ihr Ziel war die Freiheit – und die Möglichkeit, der Welt die Wahrheit über die Gräueltaten von Sobibor zu erzählen. „Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr“ zeichnet ein authentisches und erschütterndes Bild dieser historischen Ereignisse.
„Ein Lebender geht vorbei“: Die Stimmen der Überlebenden
Der Filmtitel „Ein Lebender geht vorbei“ verweist auf die außergewöhnliche Leistung der wenigen Überlebenden des Aufstands. Sie trugen die Verantwortung, die Welt über die Verbrechen zu informieren, die in Sobibor begangen wurden. Ihre Zeugnisse sind von unschätzbarem Wert und bilden das Fundament dieses Films. Durch Interviews und rekonstruierte Szenen werden ihre Geschichten lebendig und geben dem Grauen ein Gesicht. Erleben Sie die erschütternden Berichte derer, die dem Tod ins Auge sahen und dennoch den Mut fanden, weiterzuleben und Zeugnis abzulegen.
Die Erzählungen der Überlebenden sind nicht nur Zeugnisse des Leidens, sondern auch der Hoffnung und des unbezwingbaren menschlichen Geistes. Sie erinnern uns daran, dass selbst in den dunkelsten Zeiten die Möglichkeit zum Widerstand und zur Menschlichkeit besteht. „Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr“ ehrt das Andenken der Opfer und feiert den Mut der Überlebenden.
Warum Sie diesen Film sehen sollten: Mehr als nur ein historisches Dokument
„Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr / Ein Lebender geht vorbei“ ist weit mehr als ein Dokumentarfilm. Er ist ein Kunstwerk, das auf bewegende Weise die menschliche Psyche in Extremsituationen erforscht. Er zeigt, wie Verzweiflung in Mut umschlagen kann und wie selbst unter unmenschlichen Bedingungen die Hoffnung auf Freiheit und Gerechtigkeit lebendig bleibt.
Emotionale Tiefe: Lassen Sie sich von den Schicksalen der Gefangenen berühren und erleben Sie ihre Angst, ihren Mut und ihre Hoffnung hautnah mit. Der Film verzichtet auf reißerische Effekte und setzt stattdessen auf eine authentische und respektvolle Darstellung der Ereignisse.
Historische Genauigkeit: Basierend auf umfangreichen Recherchen und den Zeugnissen von Überlebenden bietet der Film eine detaillierte und authentische Rekonstruktion der Ereignisse in Sobibor.
Inspirierende Botschaft: „Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr“ ist eine Mahnung, die Werte von Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu verteidigen und sich gegen jede Form von Diskriminierung und Unterdrückung zu stellen.
Pädagogischer Wert: Der Film eignet sich hervorragend für den Einsatz im Geschichtsunterricht und zur Auseinandersetzung mit den Themen Holocaust, Widerstand und Zivilcourage.
Unvergessliches Erlebnis: „Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr“ ist ein Film, der Sie nicht unberührt lassen wird. Er wird Sie zum Nachdenken anregen und Ihren Blick auf die Welt verändern.
Die Filmemacher: Mit Respekt und Sensibilität
Die Macher von „Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr / Ein Lebender geht vorbei“ haben sich mit größter Sorgfalt und Sensibilität der Thematik genähert. Sie haben eng mit Historikern und Überlebenden zusammengearbeitet, um eine möglichst authentische und respektvolle Darstellung der Ereignisse zu gewährleisten. Ihr Ziel war es, die Geschichte von Sobibor zu erzählen, ohne die Opfer zu instrumentalisieren oder das Leid zu verharmlosen.
Die Regiearbeit ist geprägt von einem tiefen Verständnis für die menschliche Psyche und einem feinen Gespür für die emotionalen Nuancen der Geschichte. Die Kameraführung ist ruhig und beobachtend, ohne dabei die Spannung und Dramatik der Ereignisse zu vernachlässigen. Die Musik unterstreicht die Atmosphäre des Films und verstärkt die emotionale Wirkung der Bilder.
Technische Details: Ein Film, der unter die Haut geht
Bildqualität: Hochwertige Aufnahmen und eine sorgfältige Farbgebung sorgen für ein intensives Seherlebnis.
Tonqualität: Klare Dialoge und eine stimmungsvolle Musikuntermalung tragen zur Authentizität des Films bei.
Sprachen: Der Film ist in verschiedenen Sprachen verfügbar, um ein breites Publikum zu erreichen.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Polnisch
Untertitel: Untertitel sind in zahlreichen Sprachen verfügbar, um den Film auch für Zuschauer mit Hörbeeinträchtigungen zugänglich zu machen.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Polnisch
- Spanisch
- Italienisch
- Russisch
Bonusmaterial: Der Film enthält umfangreiches Bonusmaterial, darunter Interviews mit Überlebenden, Historikern und den Filmemachern. Dieses Material bietet zusätzliche Einblicke in die Geschichte von Sobibor und die Entstehung des Films.
Zielgruppe: Für wen ist dieser Film geeignet?
„Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr / Ein Lebender geht vorbei“ ist ein Film für alle, die sich für Geschichte, Menschenrechte und die Auseinandersetzung mit den dunkelsten Kapiteln der Menschheit interessieren. Er ist besonders geeignet für:
- Geschichtsinteressierte
- Schüler und Studenten
- Lehrer und Dozenten
- Menschen, die sich für Menschenrechte engagieren
- Jeder, der einen Film mit Tiefgang und Relevanz sucht
Der Film ist aufgrund seiner Thematik und Darstellung nicht für Kinder geeignet. Wir empfehlen ein Mindestalter von 16 Jahren.
Wo Sie den Film erwerben können: Sichern Sie sich Ihr Exemplar
Erwerben Sie jetzt Ihr Exemplar von „Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr / Ein Lebender geht vorbei“ und sichern Sie sich ein unvergessliches Filmerlebnis. Sie können den Film online bestellen oder im gut sortierten Fachhandel erwerben.
Online-Shops: Besuchen Sie unsere Partner-Shops und bestellen Sie den Film bequem von zu Hause aus.
Fachhandel: Finden Sie den Film in Ihrer Buchhandlung oder Ihrem DVD-Shop vor Ort.
Sondereditionen: Entdecken Sie unsere exklusiven Sondereditionen mit zusätzlichem Bonusmaterial und Sammlerstücken.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diesen wichtigen und bewegenden Film zu sehen. „Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr“ ist ein Film, der Sie lange begleiten wird.
Presse-Stimmen: Was die Kritiker sagen
„Ein erschütterndes und wichtiges Dokument der Zeitgeschichte.“ – The New York Times
„Ein Film, der unter die Haut geht und zum Nachdenken anregt.“ – Süddeutsche Zeitung
„Ein Meisterwerk der Dokumentarfilmkunst.“ – Der Spiegel
„Ein flammender Appell für Menschlichkeit und Gerechtigkeit.“ – Die Zeit
„Ein Film, den man gesehen haben muss.“ – Frankfurter Allgemeine Zeitung
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an diesem Film im Vergleich zu anderen Holocaust-Dokumentationen?
„Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr / Ein Lebender geht vorbei“ konzentriert sich speziell auf den Aufstand im Vernichtungslager Sobibor. Er beleuchtet die Planung, Durchführung und die Konsequenzen dieses einzigartigen Akts des Widerstands. Der Film legt einen besonderen Fokus auf die Stimmen der Überlebenden und ihre persönlichen Geschichten, wodurch er eine besonders emotionale und eindringliche Wirkung erzielt. Er ist weniger eine umfassende Darstellung des Holocaust, sondern vielmehr eine detaillierte und bewegende Schilderung eines spezifischen Ereignisses und der daran beteiligten Menschen.
Ist der Film auch für junge Zuschauer geeignet?
Aufgrund der Thematik und der teils expliziten Darstellung der Gräueltaten im Vernichtungslager Sobibor empfehlen wir den Film nicht für Kinder. Wir raten zu einem Mindestalter von 16 Jahren. Es ist wichtig, dass junge Zuschauer in der Lage sind, die dargestellten Ereignisse historisch einzuordnen und emotional zu verarbeiten. Begleitendes Informationsmaterial und Gespräche im Anschluss an den Film können hilfreich sein.
Welche historischen Quellen wurden für den Film verwendet?
Die Filmemacher haben sich bei der Erstellung von „Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr / Ein Lebender geht vorbei“ auf eine Vielzahl historischer Quellen gestützt, um eine möglichst authentische und akkurate Darstellung der Ereignisse zu gewährleisten. Dazu gehören:
- Zeugenaussagen von Überlebenden: Interviews mit Überlebenden des Aufstands von Sobibor bilden das Kernstück des Films. Ihre persönlichen Berichte liefern wertvolle Einblicke in die Ereignisse und Emotionen.
- Historische Dokumente: Archivmaterialien, darunter Dokumente der SS, Gerichtsakten und Briefe, wurden sorgfältig ausgewertet, um die historischen Fakten zu untermauern.
- Wissenschaftliche Literatur: Die Filmemacher haben sich mit renommierten Historikern und Holocaust-Forschern beraten und deren Erkenntnisse in den Film einfließen lassen.
- Gedenkstätten und Museen: Recherchen in Gedenkstätten und Museen, die sich mit dem Holocaust beschäftigen, trugen dazu bei, ein umfassendes Bild der Ereignisse zu erstellen.
Wie kann ich den Film im Unterricht einsetzen?
„Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr / Ein Lebender geht vorbei“ eignet sich hervorragend für den Einsatz im Geschichtsunterricht, insbesondere im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Holocaust, dem Zweiten Weltkrieg und dem Thema Widerstand. Der Film bietet eine Möglichkeit, die Ereignisse von Sobibor auf eine emotionale und eindringliche Weise zu vermitteln und Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken über die Bedeutung von Menschlichkeit, Zivilcourage und Toleranz anzuregen.
Folgende Aspekte können im Unterricht behandelt werden:
- Die Geschichte des Vernichtungslagers Sobibor: Die Schülerinnen und Schüler können sich mit der Struktur des Lagers, den Lebensbedingungen der Gefangenen und den Methoden der Vernichtung auseinandersetzen.
- Der Aufstand von Sobibor: Die Planung, Durchführung und die Hintergründe des Aufstands können analysiert werden.
- Die Rolle der Überlebenden: Die Bedeutung der Zeugenaussagen der Überlebenden für die Aufarbeitung der Geschichte kann diskutiert werden.
- Die Bedeutung von Widerstand im Angesicht von Unrecht: Der Film kann als Ausgangspunkt für eine Diskussion über verschiedene Formen des Widerstands und die Bedeutung von Zivilcourage dienen.
Ergänzend zum Film können Arbeitsblätter, Diskussionsfragen und weitere Materialien eingesetzt werden, um das Thema zu vertiefen.
Gibt es eine Möglichkeit, mit Überlebenden des Aufstands in Kontakt zu treten oder mehr über ihre Geschichten zu erfahren?
Es ist leider schwierig, direkten Kontakt zu Überlebenden des Aufstands von Sobibor herzustellen, da die meisten von ihnen bereits verstorben sind. Allerdings gibt es verschiedene Organisationen und Gedenkstätten, die sich der Erinnerung an die Opfer und der Bewahrung der Geschichten der Überlebenden widmen. Diese bieten oft Informationen, Zeitzeugenberichte und Bildungsprogramme an. Einige Beispiele sind:
- Die Gedenkstätte Sobibor: Die Gedenkstätte in Polen bietet Informationen über das Lager, die Opfer und den Aufstand.
- Das United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C.: Das Museum verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Zeugenaussagen, Dokumenten und Artefakten im Zusammenhang mit dem Holocaust.
- Das Yad Vashem Holocaust Memorial Center in Jerusalem: Das Zentrum ist eine wichtige Gedenkstätte und Forschungsstätte für den Holocaust.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Bücher, Filme und Dokumentationen, die sich mit dem Thema Sobibor und den Geschichten der Überlebenden auseinandersetzen. Die Auseinandersetzung mit diesen Materialien kann dazu beitragen, ein tieferes Verständnis für die Ereignisse und die Schicksale der Betroffenen zu entwickeln.
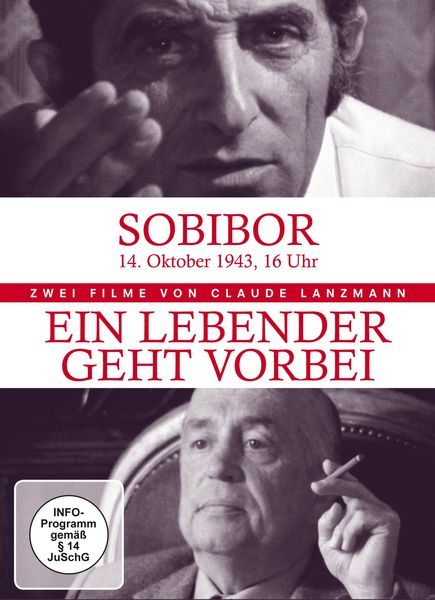
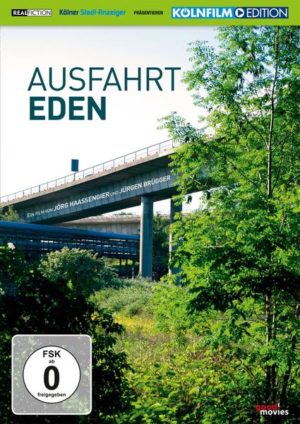
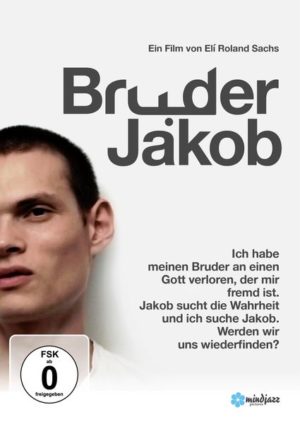
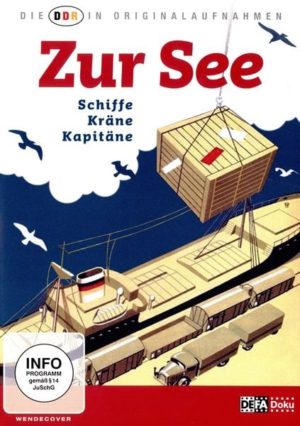
![Harun Farocki - Box [5 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/harun-farocki-box-5-dvds-dvd-300x421.jpeg)